-
Die Universität
- Herzlich willkommen
- Das sind wir
- Medien & PR
-
Studium
- Allgemein
- Studienangebot
- Campusleben
-
Forschung
- Profil
- Infrastruktur
- Kooperationen
- Services
-
Karriere
- Arbeitgeberin Med Uni Graz
- Potenziale
- Arbeitsumfeld
- Offene Stellen
-
Diagnostik
- Patient*innen
- Zuweiser*innen
- Gesundheitsthemen
- Gesundheitsinfrastruktur
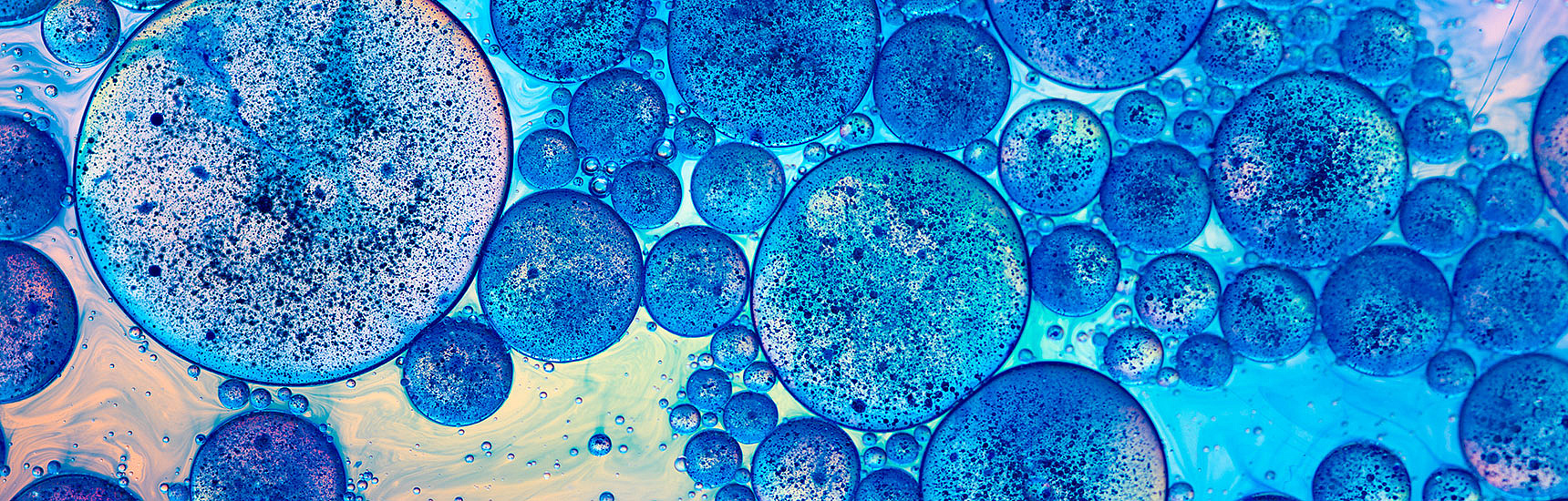
Wie Immunzellen ihre tödliche Fracht abliefern
Präzision ist für Immunzellen entscheidend: Natürliche Killerzellen und T-Zellen eliminieren infizierte oder entartete Zellen, indem sie gezielt hochgiftige Partikel freisetzen. Einen tieferen Einblick wie diese sogenannten zytotoxischen Granula freigesetzt werden, gibt nun eine neue Studie des CeMM, der St. Anna Kinderkrebsforschung, der MedUni Wien, der Med Uni Graz, des Universitätsklinikums Bonn (UKB) und der Universität Bonn. In der Fachzeitschrift Science Immunology (DOI: 10.1126/sciimmunol.ado3825) beschreibt das Team eine unerwartete Verbindung zwischen dem Fettstoffwechsel und der Fähigkeit des Immunsystems auf, seine „tödliche Fracht“ zielgenau abzugeben – und liefert neue Einblicke in Erkrankungen, die durch genetische Defekte verursacht werden.
Unser Immunsystem ist auf spezialisierte Zellen wie natürliche Killerzellen (NK-Zellen) und T-Zellen angewiesen, um gefährliche Eindringlinge wie Viren oder Krebszellen aufzuspüren und zu zerstören. Dazu setzen sie mikroskopisch kleine „Pakete“ frei, die mit hochgiftigen Molekülen gefüllt sind – sogenannte zytotoxische Granula –, welche infizierte oder entartete Zellen abtöten. Zwar konnten durch die Untersuchung von Immunerkrankungen bereits einige Schlüsselmoleküle identifiziert werden, doch weitere Moleküle, die für diesen Freisetzungsmechanismus wichtig sein könnten, sind noch unbekannt.
In ihrer aktuellen Arbeit, erschienen in Science Immunology (DOI: 10.1126/sciimmunol.ado3825), präsentiert ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Kaan Boztug, Professor an der MedUni Wien, Forschungsgruppenleiter an der St. Anna Kinderkrebsforschung, Adjunct Principal Investigator am CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin sowie Direktor der Klinik für Pädiatrische Immunologie und Rheumatologie am UKB und Mitglied vom Exzellenzcluster ImmunoSensation2 der Universität Bonn, gemeinsam mit Artem Kalinichenko, Assistenzprofessor an der Medizinischen Universität Graz und ehemaliger Senior Postdoc an der St. Anna Kinderkrebsforschung und am CeMM, sowie Jakob Huemer, ehemaliger PhD-Student am CeMM (beide ehemalige Mitglieder von Kaan Boztugs Forschungsgruppe) eine Entdeckung, die unser Verständnis der Immunabwehr grundlegend erweitert.
Mithilfe von Analysemethoden, die auf der „Genschere“ CRISPR basieren, stellten die Forscher:innen fest, dass eine unerwartete Gruppe an Gene eine zentrale Rolle bei der Freisetzung zytotoxischer Granula in menschlichen NK- und T-Zellen spielen. Überraschenderweise stehen viele dieser Gene in Zusammenhang mit dem zellulären Lipidstoffwechsel. Das Team konnte zeigen, dass bestimmte Lipide dabei helfen, dass wichtige Proteine für die kontrollierte Freisetzung der Granula an ihren korrekten Zielort innerhalb der Immunzellen gelangen – und somit das präzise Ausschalten infizierter oder entarteter Zellen sicherstellen.
Dieser Durchbruch trägt nicht nur zum besseren Verständnis der Funktionsweise von Immunzellen bei, sondern liefert auch neue Erkenntnisse über Krankheiten, die durch genetische Defekte verursacht werden – etwa seltene neurologische Störungen oder angeborene Immundefekte.
„Durch die systematische Erforschung genetischer Signalwege und die Kombination von funktioneller Genomik mit mechanistischen Folgeuntersuchungen haben wir eine neue Gruppe von Genen entdeckt, die die Funktionsweise von T- und NK-Zellen steuern und sowohl virusinfizierte Zellen als auch Tumorzellen abtöten“, sagt Ko-Erstautor Artem Kalinichenko. „Diese Erkenntnisse können helfen, genetische Erkrankungen besser zu diagnostizieren – und langfristig den Weg zu neuen Therapien eröffnen.“
„Es ist faszinierend zu sehen, dass Moleküle, die ursprünglich aus der Neurobiologie bekannt sind und mit dem Fettstoffwechsel und der Fettmodifikation in Verbindung stehen, auch für einen bestimmten Mechanismus der Immunabwehr von entscheidender Bedeutung sind“, ergänzt Jakob Huemer, ebenfalls Ko-Erstautor der Studie. „Unsere Ergebnisse werfen neue Fragen darüber auf, wie gemeinsame zelluläre Signalwege sehr unterschiedliche biologische Systeme beeinflussen.“
„Diese Arbeit zeigt, welches Potential in gemeinschaftlicher, von Neugier getriebener Forschung steckt “, fasst der leitende Autor Kaan Boztug zusammen. „Wir konnten einen völlig unerwarteten Zusammenhang zwischen der Lipidbiologie und der Funktion von Immunzellen aufdecken und damit scheinbar unabhängige biologische Prozesse miteinander verknüpfen. Diese Erkenntnisse werden uns dabei helfen, die Diagnose von Patient:innen mit seltenen Immundefekten zu verbessern, und sind auch für die zukünftige Entwicklung von Ansätzen zur Krebsimmuntherapie relevant.“
Die Studie entstand in enger internationaler Zusammenarbeit mit Forschungsteams aus Österreich, Frankreich, Schweden und Finnland und stellt einen wichtigen Schritt dar, um besser zu verstehen, wie der menschliche Körper Infektionen und Krebs bekämpft
Autor*innen: Artem Kalinichenko, Jakob Huemer, Theresa Humer, Matthias Haimel, Michael Svaton, Nicolas Socquet-Juglard, Giovanna Perinetti Casoni, Celine Prakash, Maximilian von der Linde, Julia Pazmandi, Cheryl van de Wetering, Javier Nunez-Fontarnau, Anton Kamnev, Sarah Giuliani, Martin G. Jaeger, Elisa Hahn, Sarah Dobner, Andrea Rukavina, Elise Sylvander, Jacqueline Seigner, Christina Rashkova, Birgit Hoeger, Michael W. Traxlmayr, Manfred Lehner, Yenan T. Bryceson, Janna Saarela, Thomas Hannich, Irinka Castanon, Georg Winter, Loïc Dupré and Kaan Boztug
Förderung: Diese Arbeit wurde vom Europäischen Forschungsrat (ERC), dem Wissenschafts- und Technologiefonds Wien (WWTF), der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), der Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien), dem Bundesministerium für Digitales und Wirtschaft und der Nationalen Forschungs-, Technologie- und Entwicklungsstiftung Österreichs an die Christian Doppler Forschungsgesellschaft unterstützt.
Das CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist eine internationale, unabhängige und interdisziplinäre Forschungseinrichtung für molekulare Medizin unter wissenschaftlicher Leitung von Giulio Superti-Furga. Das CeMM orientiert sich an den medizinischen Erfordernissen und integriert Grundlagenforschung sowie klinische Expertise, um innovative diagnostische und therapeutische Ansätze für eine Präzisionsmedizin zu entwickeln. Die Forschungsschwerpunkte sind Krebs, Entzündungen, Stoffwechsel- und Immunstörungen, sowie seltene Erkrankungen und Altern. Das Forschungsgebäude des Institutes befindet sich am Campus der Medizinischen Universität und des Allgemeinen Krankenhauses Wien. www.cemm.at
Die St. Anna Kinderkrebsforschung (St. Anna CCRI) ist eine internationale und interdisziplinäre Forschungseinrichtung, die das Ziel verfolgt, durch innovative Forschung diagnostische, prognostische und therapeutische Strategien für die Behandlung von an Krebs erkrankten Kindern und Jugendlichen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Unter Einbeziehung der spezifischen Besonderheiten kindlicher Tumorerkrankungen arbeiten engagierte Forschungsgruppen auf den Gebieten Tumorgenomik und -epigenomik, Immunologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Bioinformatik und klinische Forschung gemeinsam daran, neueste wissenschaftlich-experimentelle Erkenntnisse mit den klinischen Bedürfnissen der Ärzt*innen in Einklang zu bringen und das Wohlergehen der jungen Patient*innen nachhaltig zu verbessern. www.ccri.at | www.kinderkrebsforschung.at
Die Medizinische Universität Wien (kurz: MedUni Wien) ist eine der traditionsreichsten medizinischen Ausbildungs- und Forschungsstätten Europas. Mit rund 8.600 Studierenden ist sie heute die größte medizinische Ausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum. Mit mehr als 6.500 Mitarbeiter:innen, 30 Universitätskliniken und zwei klinischen Instituten, zwölf medizintheoretischen Zentren und zahlreichen hochspezialisierten Laboratorien zählt sie zu den bedeutendsten Spitzenforschungsinstitutionen Europas im biomedizinischen Bereich. Die MedUni Wien besitzt mit dem Josephinum auch ein medizinhistorisches Museum. www.meduni.ac.at
Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) verbindet als eines der leistungsstärksten Universitätsklinika Deutschlands Höchstleistungen in Medizin und Forschung mit exzellenter Lehre. Jährlich werden am UKB über eine halbe Million Patienten ambulant und stationär versorgt. Hier studieren rund 3.500 Menschen Medizin und Zahnmedizin, zudem werden jährlich über 600 Personen in Gesundheitsberufen ausgebildet. Mit rund 9.900 Beschäftigten ist das UKB der drittgrößte Arbeitgeber in der Region Bonn/Rhein-Sieg. In der Focus-Klinikliste belegt das UKB Platz 1 unter den Universitätsklinika in NRW und weist unter den Universitätsklinika bundesweit den zweithöchsten Case-Mix-Index (Fallschweregrad) auf. 2024 konnte das UKB knapp 100 Mio. € an Drittmitteln für Forschung, Entwicklung und Lehre einwerben. Das F.A.Z.-Institut zeichnete das UKB im vierten Jahr in Folge als „Deutschlands Ausbildungs-Champion“ und „Deutschlands begehrtesten Arbeitgeber“ aus. Aktuelle Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht unter: geschaeftsbericht.ukbonn.de
An der Medizinischen Universität Graz (Med Uni Graz) forschen, lehren und lernen über 2.500 Mitarbeiter*innen im wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Bereich sowie rund 5.000 Studierende gemeinsam mit Innovationsgeist für Gesundheit und Wohlbefinden der Patient*innen. Die Med Uni Graz bildet ein Zentrum der innovativen Spitzenmedizin im Süden Österreichs und ist gleichzeitig attraktiver Lebensraum bzw. Arbeitsplatz für Mitarbeiter*innen sowie Studierende und wesentlicher Teil der Betreuung von Patient*innen am Standort. An der Umsetzung der vielfältigen Vorhaben wirken alle an der Med Uni Graz tätigen Menschen mit: Wissenschafter*innen, Forschende, Ärzt*innen, Studierende, Lehrende und die vielen weiteren Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Berufsgruppen verstehen sich als „Pioneering Minds“, die durch ihre tägliche Arbeit und ihr wertschätzendes und offenes Miteinander den Spirit und die Innovationskraft der Med Uni Graz ausmachen.
Kontakt und weitere Informationen
Ass.-Prof.
Artem Kalinichenko PhD.
Artem Kalinichenko PhD.
Lehrstuhl für Immunologie
Medizinische Universität Graz
T: +43 316 385 71152


